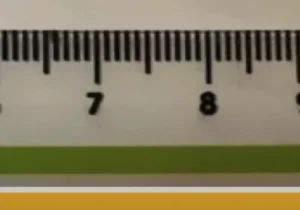Frau Kleiberle ist ja letztes Jahr Witwe geworden, genauergesagt vor etwas mehr als einem Jahr. Das erkennt man daran, daß sie jetzt wieder helle Kleidung trägt, das Schwarz hat sie nach einem Jahr abgelegt und gewandet sich jetzt in fröhlichem Dunkelblau, einem frischen Dunkelgrau oder auch mal in ein freches Anthrazit.
So ohne ihren Franz ist ihre Wohnung ziemlich leer, da hilft ihr auch das Dauergesabbel von Richterin Salesch und Kollegen, das aus dem Fernseher einen Klangteppich in den Hintergrund legt, nicht viel weiter. Trifft man sie, sieht man ihr schon von Weitem an, daß sie leidet, daß sie einsam ist und daß sie ihren Franz vermißt.
Genau dieser Umstand ist es, der mich veranlasst, ihre Einladung anzunehmen. Schon als ihr Franz noch lebte, hatte sie mich und die Allerliebste eingeladen, doch dann kamen der überraschende Tod ihres Mannes und die einjährige Trauerzeit dazwischen. Vergessen hatte sie die Einladung aber nicht, ich hingegen schon. Denn wenn man einmal von den überfallartigen Attacken der Frau Ruckdäschl absieht, pflege ich normalerweise keinen intensiveren Kontakt zur Nachbarschaft. Wann immer nötig grüße ich, bleibe sogar, wenn es unumgänglich ist, mal bei den schwatzenden Eingeborenen stehen und gebe, mehr aus Notwendigkeit, meinen belanglosen Senf dazu, aber ansonsten halte ich Distanz. Obwohl ich meine, damit das Erforderliche geleistet zu haben, halten mich vermutlich dennoch alle Nachbarn für einen griesgrämigen, arroganten Schnösel.
Griesgrämig deshalb, weil ich nicht wegen jeder Banalität aus dem Häuschen gerate und arrogant, weil ich nach der Schrift schwätz‘. Leute die Hochdeutsch reden, gelten hier gemeinhin als eingebildet, arrogant, hochnäsig und verachtungswürdig. Aber was kann ich denn dafür, daß mir dieses Gelenk im Kiefer fehlt, das man benötigt, um den Unterkiefer so weit vorzuschieben, wie es notwendig ist, um den weichen, breiten Dialekt der Eingeborenen vom Neckar zu sprechen. Ich habe es doch schon so oft versucht und jedes Mal ist es in die Hose gegangen. Insgeheim behaupte ich ja, daß die sich ihren Dialekt und die darin verwendeten Bezeichnungen für bestimmte Gegenstände während des laufenden Gesprächs ständig neu ausdenken.
Neulich stehe ich auf dem Balkon und höre, wie sich zwei Frauen aus der Nachbarschaft unterhalten. Dazu muß man wissen, daß sich die Eingeborenen nicht nur in einer nahezu unverständlichen Mundart unterhalten, die für Fremde wie „muschukannschuhaschämohl“ klingt, sondern sie tun das auch immer (immer, immer, immer) in einer Lautstärke, als müssten sie einen Rasenmäher übertönen. Leise funktioniert diese Sprache offenbar gar nicht, man muß sich anschreien.
Da schreien sich diese Frauen also an. Die Erste sagt:
„Sag ämohl hasch du ä große Dippe?“
„Nä, isch nämm imma de große Haffe.“
„Des is awwa schaad, isch bräuscht ä gonz großer Dopp.“
„Isch kennt dir mei großer Pott gäwwe.“
Bei diesem Fragment der Unterhaltung wollen wir es einmal bewenden lassen. Manche werden es verstanden haben, den anderen sei gesagt, daß die Begriffe Dippe, Haffe, Dopp und Pott alle das Gleiche bezeichnen, nämlich einen Topf. Im Verlaufe der gut zwanzigminütigen Unterhaltung fielen noch etwa 26 andere Bezeichnungen für ein und dasselbe.
Ich habe später die Allerliebste gefragt, was denn der Unterschied zwischen einem Haffe und einem Dippe sei. Anke schaut mich verwundert an und sagt die Worte, die mich dann noch einige Tage beschäftigt haben:
„Des weiß doch wohl jeder, odda? Ä Dippe ist mehr so wie än Haffe, während der Haffe fast schon ä Dopp is.“
Nee, nee, keine Bange, die Allerliebste spricht für gewöhnlich schon in einer Sprache, die ich verstehe, zumindest mit mir und unseren, Gott sei es gedankt, Hochdeutsch sprechenden Kindern. Aber hin und wieder, so auf der Arbeit, beim Einkaufen, im Gespräch, am Telefon verfällt sie doch in die hiesige Mundart. Will sie mich ärgern, spricht sie auch mit mir so. Will sie hingegen, daß ich nicht verstehe was sie sagt, beispielsweise, wenn sie mich beleidigen will, dann spricht sie Balkanisch und ich weiß bis heute nicht genau, ob das Ungarisch oder Mazedonisch ist.
Kommen wir aber zurück auf unsere Frau Kleiberle. Die hatte ich vor über einem Jahr beim Metzger getroffen und wir waren den Weg nach Hause gemeinsam gegangen. Dabei erzählte sie mir, daß sie Schnitzelfleisch gekauft habe, weil sie für ihren Franz immer Schnitzel nach einem ganz besondere Rezept zubereite. Ich habe das damals abgenickt aber irgendwas muß an meinem Nicken gewesen sein, denn die Kleiberle fühlte sich dazu gemüßigt zu sagen: „Die müssen Sie auch mal probieren! Wissen Sie was? Ich lade Sie uns Ihre Frau demnächst einmal zu meinen Schnitzeln ein.“
Bei dieser Einladung ist es über ein Jahr lang geblieben und jetzt wird das Ganze wieder aktuell. Anke und ich sollen heute Abend zu Frau Kleiberle hochkommen, sie macht uns ihre Schnitzel. Anke ist begeistert. Sie geht ja gerne wo hin und hat auch gerne, wenn jemand zu Besuch kommt; ich persönlich halte es da mehr mit meinen stammesgeschichtlichen Vorfahren und würde am Liebsten mit der Keule in der Hand alle Eindringlinge vertreiben.
Am Abend sitzen wir zu Dritt in Frau Kleiberles Wohnzimmer und trinken Eierlikör.
„Eierlikör ist ja das Größte für mich“, sagt Frau Kleiberle und fügt hinzu: „Diese Flasche habe ich schon seit drei Jahren für besondere Gäste aufbewahrt.“
Anke trinkt trotzdem und ich denke intensiv darüber nach, daß Eierlikör für gewöhnlich nur eine sehr begrenzte Haltbarkeit hat, aber vielleicht haben wir ja Glück und die Flasche war noch zu, hat dunkel und kühl gestanden und die Salmonellen haben sich dadurch in ihrem Paarungsverhalten etwas zurückgehalten. Außerdem, so muß ich sagen, schmeckt der Eierlikör hervorragend und so wehre ich mich auch nicht, als mir unsere Nachbarin noch ein zweites Mal einschenkt.
Ja und so sitzen wir da und sitzen und sitzen und Frau Kleiberle erzählt von ihrem toten Franz. Ehrlicherweise muß ich sagen, daß sie vom lebenden Franz erzählt, das aber sehr ausgiebig und lang. Naja, man will so eine anthrazitfarbene Witwe auch nicht vor den Kopf stoßen und deshalb hören wir ihr geduldig zu.
Frau Kleiberle ist in ihren Erzählungen schon am Ende der Schulzeit ihres Franz angekommen und will gerade von seinem Eintritt in die Schneiderlehre berichten, da fasse ich mir ein Herz und erkundige mich vorsichtig nach dem geplanten Essen. Das mache ich natürlich sehr subtil, indem ich bei der nächsten Runde Eilerikör, es ist die Elfte, sage: „Ich muß jetzt mal langsam machen mit dem Eierlikör, sonst habe ich nachher keinen Appetit mehr.“
Das wirkt! Die Kleiberle springt auf, schlägt sich mit der flachen Hand vor die Stirn und sagt: „Gut, daß Sie es sagen, meine Güte, da hätte ich doch bald die Schnitzel vergessen!“
Während sie in die Küche geht erzählt sie weiter von ihrem Franz. Sie hebt dazu ihre Stimme etwas und ab und zu beendet sie ihre Sätze mit „nicht wahr?“ oder „stimmts?“ und kontrolliert anhand unserer, in die Küche gerufenen Antworten, ob wir überhaupt noch zuhören. Dieses Spiel wird nur unterbrochen, als sie die Schnitzel platt klopft. Danach plappert sie sofort weiter und ist gerade an der Stelle angekommen, die davon handelt, daß ihr Franz ja dann doch kein Schneider, sondern Maurer geworden ist, als sie mit den flachgeklopften rohen Schnitzeln ins Wohnzimmer kommt. Sie stellt die Platte mit den Fleischlappen mitten auf den Tisch, plappert vom Franz und deckt mit schönen großen Tellern und ihrem besten Silbersteck.
Ich will gerade etwas sagen, doch die Allerliebste tritt mir unterm Tisch ans Schienbein. Das macht sie gerne, das macht sie oft und deshalb bin ich da schon ziemlich abgestumpft. Aus diesem Grunde tritt sie immer mehrmals zu, so auch an diesem Abend.
Die Kleiberle verschwindet in der Küche, plappernd versteht sich, und die Allerliebste sagt:
„Sei bloß ruhig!“
„Wieso? Siehst du denn nicht, daß das Fleisch noch roh ist?“
„Die nimmt das bestimmt gleich mit in die Küche und brät es.“
„Du, ich glaube, die ist etwas durch den Wind. Ob die überhaupt genau blickt, was sie gerade macht?“
Zunächst muß diese Frage unbeantwortet bleiben, denn die Anthrazitfarbene ist wieder zurück. Aber sie holt nicht die Fleischplatte, sondern setzt sich. In ihrem Plappern ist sie inzwischen im Dritten Reich angekommen und schildert unter Tränen, wie der Einsatz ihres Franz‘ an der Ostfront jäh seine Pläne, Maurer zu werden, zunichte gemacht hat. Dieses Kapitel und vor allem die anschließende Kriegsgefangenschaft scheinen Frau Kleiberle besonders zuzusetzen, denn sie gerät ins Schluchzen und dicke Tränen kullern über ihre Wangen. Die Schnitzel stehen immer noch, zwar geklopft aber roh, vor uns und unter Tränen nimmt die Kleiberle eine Gabel und legt jedem von uns einen kalten Fleischlappen auf den Teller. Dann verschwindet sie schluchzend wieder in der Küche, um noch eine Falsche Eierlikör zu holen. „Essen Sie!“, ruft sie aus der Küche. „Langen Sie kräftig zu!“
Ich werfe meiner Allerliebsten einen hilflosen Blick zu, doch die schaut mich auch nur kuhäugig an und zuckt mit den Schultern.
Da kommt mir eine Idee! Da es drückend warm ist, steht am anderen Ende ein Fenster offen. Ich werfe einen Blick in Richtung Küche und versuche an der Lautstärke von Frau Kleiberles Plappern und Schluchzen festzustellen, ob sie sich schon auf dem Rückweg befindet. Das scheint nicht der Fall zu sein. So nehme ich den kalten Schnitzellappen und werfe ihn beherzt zum offenen Fenster hinaus!
Eventuell sollte ich noch erwähnen, daß dieses Unterfangen nicht von Erfolg gekrönt ist. Denn zur Abwehr schädlicher Insekten hat die Kleiberle ein Fliegengitter vor ihr Fenster gezimmert, was ich allerdings vorher nicht gesehen habe. Und genau an diesem Fliegengitter klebt jetzt mein Schnitzel.
Während Anke mir hämmernd ans Schienbein tritt, kommt die Kleiberle wieder herein, in den Händen eine neue Flasche Eierlikör.
„Ach, Sie haben schon aufgegessen? Nehmen Sie noch eins, los, nehmen Sie!“
„Nein, nein, ich kann wirklich nicht mehr, ich bin ja sowas von satt“, sage ich und reibe mir meinen Bauch.
„Papperlapapp, so ein kräftiger Mann wie Sie, der kann noch eins essen“, sagt die Kleiberle und will mir noch ein Schnitzel geben, da kommt ihr meine Frau, die ich bis zu diesem Moment abgöttisch geliebt habe, zuvor und sagt: „Wissen Sie was, Frau Kleiberle, der kann meins haben, ich mache gerade eine Diät.“
Sagt’s, legt mir ihr Schnitzel auf den Teller und grinst triumphierend. – Natter!
Der grauen Witwe ist’s egal, sie schenkt uns bestimmt zum 15ten Mal Eierlikör ein und schluchzt erneut auf, als sie uns schildert, wie knapp der Speck doch nach dem Krieg gewesen ist. Die Trauer, der seltene Besuch, die alkoholische Wirkung des Eierlikörs und vielleicht auch das Alter, das sind die Gründe dafür, daß Frau Kleiberle ganz offensichtlich überhaupt nicht kapiert, daß sie uns rohes Fleisch vogesetzt hat. Jedenfalls kann ich es nicht essen. Zum einen mag ich kein rohes Fleisch und zum anderen habe auch ich schon eine größere Menge von Frau Kleiberles Eierlikör intus und mittlerweile bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob sich die Salmonellen darin an das Trauerjahr gehalten haben. In meinem Bauch grummelt und murmelt es und ich verspüre zunehmend das Bedürfnis, das stille Örtchen aufzusuchen.
Aber genau! Das ist doch die Idee! Als die Kleiberle gerade nicht guckt, nehme ich das Schnitzel, rolle es geschwind zusammen und kaschiere es mit der Hand. „Ich müsste dann mal wohin“, sage ich und begebe mich ins Bad. Dort werfe ich das Schnitzel ins Klo und spüle es hinunter. Erleichterung macht sich breit und ich freue mich, daß ich doch so ein geniales Hirn habe. Nachher würde ich bei passender Gelegenheit auch das Schnitzel vom Fliegengitter kratzen und ebenfalls hier im Klo entsorgen.
Während ich mir die Hände wasche, gurgelt es aus Frau Kleiberles Toilette und ich sehe, wie der Wasserstand darin langsam steigt.
Naja, das Schnitzel war sehr groß und vielleicht könnte es eine gute Idee sein, rasch noch ein kleines Bündel Toilettenpapier hinterher zu spülen.
Das mache ich auch, aber das Papier will nicht runtergehen und der Wasserstand hat nach dem abermaligen Ziehen der Spülung bedrohliche Ausmaße angenommen. Ein Pümpel ist weit und breit nicht in Sicht, also nehme ich Frau Kleiberles gedrechselte Klobürste. Damit will ich das Toilettenpapier ganz tief ins Rohr stoßen, damit sich ein größerer Druck aufbaut und das irgendwo im Rohr befindliche Schnitzel freigespült wird.
Es passiert aber genau das Gegenteil. Das Papier löst sich zu häßlichen Flocken auf, die sich um die Borsten der Bürste wickeln, der Wasserstand steigt gurgelnd weiter und die ersten Rinnsale finden ihren Weg über den Rand der Toilette.
Handtücher müssen her! Mit denen wische ich, was da zu wischen ist und stoße nochmals kräftig mit der Klobürste in die Toilette.
Endlich! Ein gurgelndes Geräusch verrät mir, daß sich das Schnitzel nun tatsächlich auf dem Weg nach unten in die Kanalisation befindet. Das Wasser rauscht hinterher, die Überschwemmungsgefahr ist schlagartig gebannt. Leider habe ich bei dieser Aktion die Klobürste zerbrochen, aber die war ja sowieso alt.
Irgendwie gelingt es mir Ordnung zu machen, die zerbrochene Klobürste stelle ich in ihren Ständer und wenn man sie nicht anfasst, sieht es so aus, als sei sie noch intakt. Im Wohnzimmer finde ich nur die Allerliebste vor, Frau Kleiberle ist mal wieder in der Küche. Das Schnitzel vom Fliegengitter ist verschwunden und ich habe schon die Befürchtung, die Kleiberle könne es entdeckt haben, doch meine Frau deutet bloß auf ihre Handtasche und murmelt: „Für den Hund.“
Ich grinse und freue mich darüber, daß die diversen kleinen Unglücke an diesem Abend doch noch glimpflich ausgegangen sind.
Unsere Nachbarin weint immer noch, die Erinnerung an ihren Franz hat sie voll ergriffen. „Wissen Sie, der Franz, das war ja so ein geschickter Handwerker. Direkt nach dem Krieg, als keiner was hatte, da hat er seinen warmen Wollmantel auf dem Schwarzmarkt eingetauscht. Ein bißchen Holz, ein paar Schweineborsten, das war alles, was er dafür bekommen hat. Aber aus dem Holz und den Borsten hat er uns unsere erste eigene Klobürste gemacht. Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für uns bedeutet hat, ein bißchen Luxus. Ich habe die Bürste immer noch, wir haben sie 60 Jahre lang in Ehren gehalten und jetzt erinnere ich mich jedes Mal an meinen Franz, wenn ich das Klo putze.“
Nur mit Mühe und Not kann ich Frau Kleiberle davon abhalten, uns auf der Stelle diese Bürste vorzuführen. Ich gebe Anke einen versteckten Wink und wir verabschieden uns dann doch recht zügig.
Ich glaube, in den nächsten Tagen werde ich aufpassen müssen, daß ich unserer Nachbarin nicht begegne…
Hashtags:
Ich habe zur besseren Orientierung noch einmal die wichtigsten Schlagwörter (Hashtags) dieses Artikels zusammengestellt:
Keine Schlagwörter vorhanden