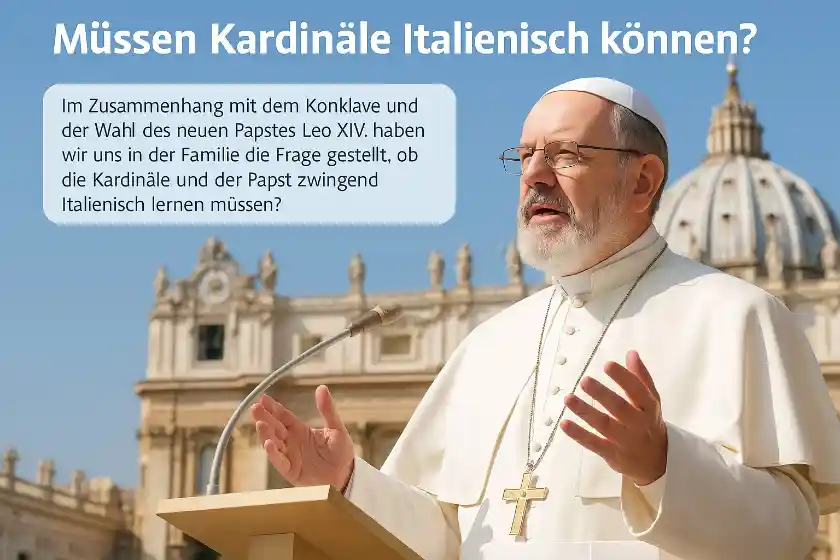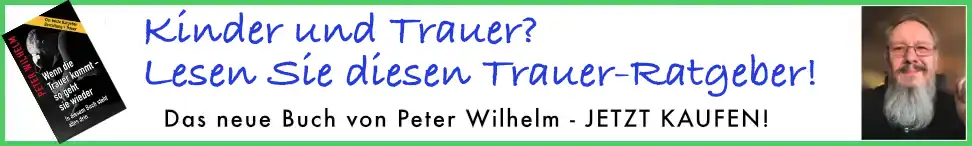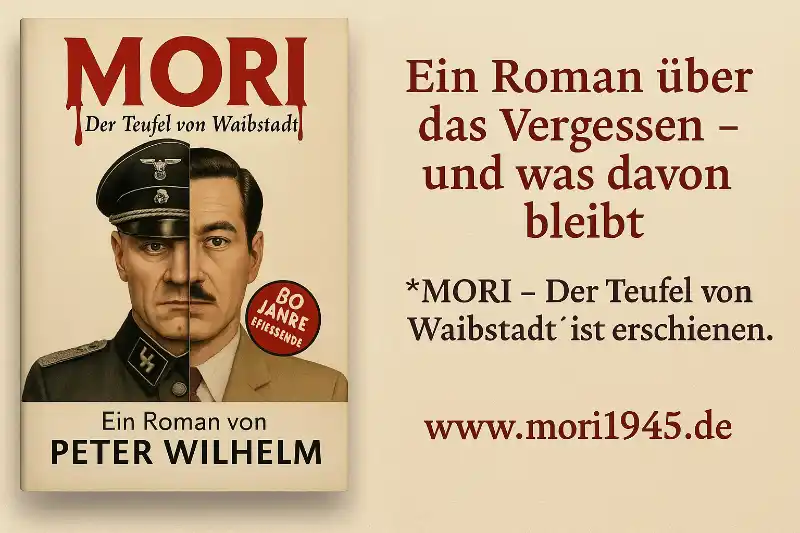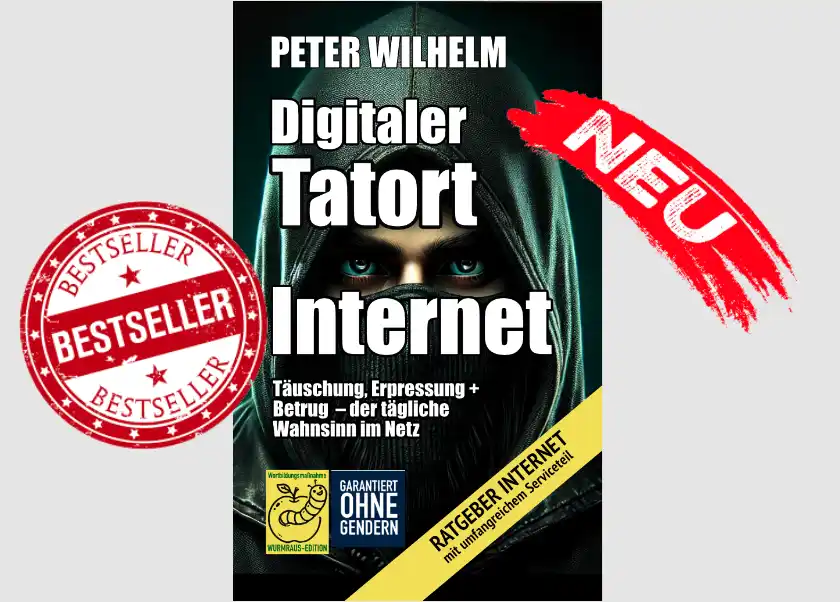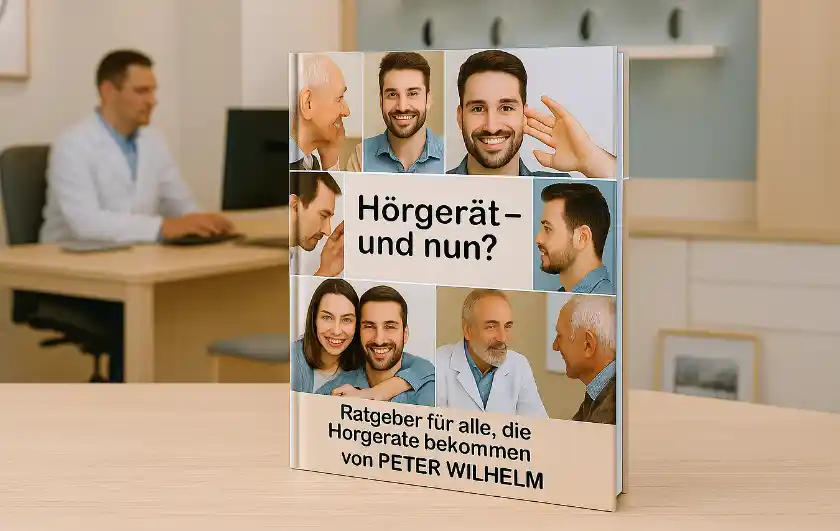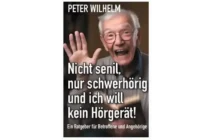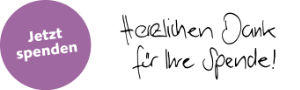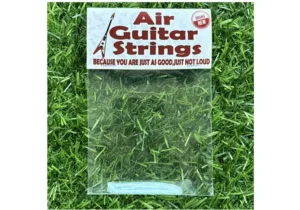Schon bei seinen ersten Auftritten glänzte der neue Papst Leo XIV. mit profunden Italienisch-Kenntnissen. Müssen Kardinäle Italienisch können?
Nein, Kardinäle müssen nicht zwingend Italienisch lernen, aber es ist in der Praxis sehr hilfreich – und fast schon üblich. Es gibt keine Vorschrift, die besagt, dass ein Kardinal der römisch-katholischen Kirche die italienische Sprache erlernen muss. Es ist aber so, dass das zumindest stark erwartet wird. Ohne ausreichende Sprachkenntisse ist ein Fortkommen in der Kurie und in der Karriere fast nicht möglich.
Warum Italienisch für Kardinäle wichtig ist:
- Der Vatikan als Zentrum:
Da der Heilige Stuhl in Rom sitzt, sind die meisten administrativen Abläufe, Sitzungen und offiziellen Texte der vatikanischen Behörden auf Italienisch verfasst. - Kommunikation im Alltag:
Viele Kardinäle wohnen zeitweise oder dauerhaft in Rom, insbesondere wenn sie in der Kurie (der päpstlichen Verwaltung) tätig sind. Italienischkenntnisse erleichtern den Alltag enorm – vom Einkauf bis zur Konferenz. - Papstwahl (Konklave):
Während des Konklaves wird oft Italienisch gesprochen, auch wenn Übersetzungen bereitgestellt werden. Wer Italienisch versteht, ist klar im Vorteil. - Liturgie und Zeremonien:
Die römisch-katholische Liturgie ist zwar internationalisiert (z. B. Latein, Landessprachen), aber viele vatikanische Zeremonien – auch informelle – laufen auf Italienisch.
In der Geschichte gibt es andere Beispiele
Mittelalter und frühe Neuzeit
- In dieser Epoche war Latein die dominierende Sprache der Kirche, nicht Italienisch.
- Päpste, die aus Frankreich, Spanien oder dem Heiligen Römischen Reich stammten, hatten oft keinen Bezug zur italienischen Sprache, sprachen aber meist fließend Latein.
- Beispiel: Papst Urban V. (1362–1370) stammte aus Südfrankreich und residierte zunächst in Avignon – seine Italienischkenntnisse waren eher gering, was im damaligen Kontext aber auch keine große Rolle spielte.
19. Jahrhundert und darüber hinaus
Seit dem Ende des Kirchenstaats (1870) und der nationalen Einigung Italiens wurde Italienisch in vatikanischen Kontexten immer bedeutender – aber nicht zwingend vorgeschrieben.
Es ergab sich aber, dass die Päpste Italiener waren.
Italiener, sprach Italienisch.
Ebenfalls Italiener, keine Probleme mit der Sprache.
Kam aus Venetien, sprach einen lokalen Dialekt, tat sich mit dem Hochitalienischen zu Beginn etwas schwer.
Italiener mit diplomatischer Ausbildung – sprach fließend Italienisch, Französisch und Latein.
Päpste von 1922 bis 1978 – alle Italiener
In diesem Zeitraum waren sämtliche gewählten Päpste gebürtige Italiener, was angesichts der dominierenden Kurie und der politischen Lage im 20. Jahrhundert (Faschismus, Zweiter Weltkrieg, Kalter Krieg) kaum überrascht. Italienisch war für sie Muttersprache oder zumindest Alltagssprache.
Papst Pius XI. (1922–1939)
• Geboren in Desio (Lombardei).
• Sprach neben Italienisch auch Latein, Französisch und Deutsch.
• Er war Bibliothekar und Gelehrter, also sprachlich sehr versiert.
• Er verhandelte mit Mussolini die Lateranverträge von 1929.
Papst Pius XII. (1939–1958)
• Geboren in Rom als Eugenio Pacelli.
• Muttersprache Italienisch, aber auch exzellente Fremdsprachenkenntnisse (Deutsch, Französisch, Latein, Spanisch, Englisch).
• Er war jahrzehntelang Diplomat, u. a. Nuntius in Deutschland.
• Galt als sehr redegewandt und hochgebildet.
Papst Johannes XXIII. (1958–1963)
• Geboren in Sotto il Monte, Bergamo.
• Sprach Hochitalienisch, aber mit ländlichem Akzent.
• Sein freundliches, volksnahes Auftreten machte ihn auch sprachlich beliebt.
• Sprach Französisch und Latein fließend.
Papst Paul VI. (1963–1978)
• Geboren in Concesio, Brescia.
• Elegant im Ausdruck, hochgebildet, mit diplomatischem Stil.
• Sprach ausgezeichnetes Italienisch und war für seine feine, präzise Sprache bekannt.
• Ebenfalls Fremdsprachenkenner: Französisch, Englisch, Spanisch, Deutsch, Latein.
Papst Johannes Paul I. (1978)
• Papst für 33 Tage, vom 26. August bis zum 28. September 1978
• Geboren in Forno di Canale (heute: Canale d’Agordo) in der Region Venetien.
• Sprach Italienisch als Muttersprache, allerdings stark gefärbt vom venezianischen Dialekt, den er auch als Papst gelegentlich einfließen ließ.
• Galt als sehr bescheiden, klar im Ausdruck, ohne rhetorische Effekthascherei – was ihn sprachlich von seinen Vorgängern unterschied.
• Trat auch sprachlich besonders volksnah auf, sprach verständlich und ohne päpstlichen Pathos.
• Hatte Kenntnisse in Latein und Französisch, war aber vor allem als Seelsorger, nicht als Diplomat oder Sprachvirtuose bekannt.
Von 1922 bis 1978 stammten alle Päpste aus Italien – Sprachbarrieren gab es in dieser Zeit nicht. Italienisch war nicht nur Amts- und Verkehrssprache, sondern auch kulturelle Selbstverständlichkeit. Erst mit der Wahl von Johannes Paul II. 1978 wurde die internationale Ausrichtung des Papstamtes auch sprachlich sichtbar.
Päpste aus anderen Ländern – mit Sprachbarrieren
Papst Johannes Paul II. (1978–2005)
• Gebürtiger Pole.
• Sprach bei seiner Wahl 1978 kein fließendes Italienisch, bemühte sich aber sofort um intensive Sprachpraxis.
• Er hielt seine erste Rede auf Italienisch mit starkem Akzent, gewann aber mit seinem Charisma schnell die Herzen der Italiener.
• Wurde später nahezu perfekt in der Sprache.
Papst Benedikt XVI. (2005–2013)
• Deutscher, sprach zwar bei Amtsantritt bereits Italienisch, aber mit deutlichem deutschen Akzent.
• War zuvor viele Jahre in Rom tätig, deshalb war die Sprachkompetenz gut – aber eben nicht muttersprachlich.
Papst Franziskus (seit 2013)
• Argentinier, italienischer Herkunft.
• Sprach bei Amtsantritt bereits gutes Italienisch, aber mit starkem Einfluss des Spanischen.
• Auch er hatte als Kardinal viele Jahre in Rom verbracht und galt als sprachlich gewandt.
Kurioses und Bemerkenswertes
Als „Papa“ nicht „Vater“, sondern „Käse“ bedeutete
Als Johannes Paul II. 1978 zum ersten Mal auf Italienisch sprach, war das Publikum gerührt – aber nicht alles klappte glatt. Der Papst sagte damals:
„Se non mi capite, vi prego di correggermi“
(Wenn ihr mich nicht versteht, bitte korrigiert mich.)
Trotz des charmanten Akzents wurde schnell klar: Der neue Papst sprach kein fließendes Italienisch. Was jedoch niemand laut korrigierte: In einem frühen Interview hatte er Papa statt Il Papa gesagt – und das bedeutet im Italienischen nicht „der Papst“, sondern „Käse“. Die italienischen Journalisten waren höflich genug, es durchgehen zu lassen.
Verwechslung mit einem Geheimdienstler
Joseph Ratzinger (der spätere Benedikt XVI.) war viele Jahre als Theologe in Rom tätig. In seinen ersten Jahren sprach er nur holpriges Italienisch. Er konnte aber italienische Texte nahezu perfekt vorlesen.
Einmal, so berichtet ein Journalist, sei er in einem vatikanischen Amt von einem Pförtner für einen deutschen Geheimdienstbeamten gehalten worden – da er schweigsam, hochgewachsen, korrekt gekleidet und „zu ruhig für einen Theologen“ war.
Das lag daran, dass Ratzinger sich scheute, im Alltag frei Italienisch zu sprechen.
Kurien-Italienisch: Eine Sprache für sich
Viele Kardinäle, die in der römischen Kurie arbeiten, sprechen eigentlich ein „Kurien-Italienisch“ – eine Mischung aus veraltetem Verwaltungsdeutsch, Lateinismen und formelhaften Ausdrücken.
Ein Kardinal aus Osteuropa meinte einmal süffisant:
„Ich habe nie Italienisch gelernt. Ich habe Kurien-Altitalienisch überlebt.“
Ein Sprachforscher bezeichnete diese Sprachform einmal scherzhaft als „Bürovulgärlatein mit katholischer Intonation“.
Die Kunst, nichts zu sagen – aber sehr höflich
Ein brasilianischer Kardinal wurde gefragt, wie er denn ohne Italienisch im Vatikan zurechtkomme. Seine Antwort:
„Ich habe gelernt, auf Italienisch zu nicken, auf Italienisch zu lächeln – und auf Italienisch zu sagen, dass ich nichts verstanden habe.“
Der Sprachkurs nach der Wahl
Ein Kardinal aus Afrika hatte zur Sicherheit einen Italienisch-Kurs in seiner Reisetasche, als er zum Konklave reiste. Auf Nachfrage erklärte er:
„Ich will nicht überrascht werden, falls man mir die weiße Soutane anbietet.“
Er wurde zwar nicht gewählt, aber sprach nach seiner Rückkehr besser Italienisch.
Müssen Päpste und Kardinäle fließend Latein sprechen?
Und wie ist das mit Latein? Allgemein wird oft angenommen, Latein sei so etwas wie die Verkehrssprache im Vatikan. Aber müssen Päpste und Kardinäle wirklich fließend Latein sprechen können?
Nein – aber sie sollten es zumindest verstehen und anwenden können. Latein ist nach wie vor die offizielle Amtssprache des Vatikans. Fast alle rechtsverbindlichen Dokumente – Enzykliken, Lehrschreiben, Dogmen – erscheinen in einer lateinischen Editio typica, also einer verbindlichen Ausgabefassung. Die alltägliche Kommunikation in der Kurie findet jedoch auf Italienisch statt.
Für Kardinäle, besonders solche mit Aufgaben in der vatikanischen Verwaltung, sind Lateinkenntnisse hilfreich, aber keine Pflicht. Viele beherrschen Latein schriftlich besser als mündlich – es wird kaum noch gesprochen, dafür gelesen, zitiert und übersetzt.
Auch Päpste sind nicht verpflichtet, fließend Latein zu sprechen. Die meisten verstehen es – einige, wie Benedikt XVI., waren geradezu brillante Lateiner. Andere, wie Franziskus, lassen ihre Texte ins Lateinische übersetzen. In der Liturgie jedoch ist Latein weiterhin präsent, besonders bei großen, internationalen Feiern im Vatikan.
Kurz gesagt: Latein ist im Vatikan das elegante, ehrwürdige Parkett – aber nicht die Straße, auf der man täglich geht.
Vatikanisches Büro-Latein: Wenn keiner spricht, aber alle zustimmen
Latein gilt gemeinhin als tote Sprache. Im Vatikan aber lebt es weiter – allerdings in einer Form, die jeden Altphilologen sanft weinen lässt. Willkommen im Reich des Büro-Lateins, wo Formeln ewig sind, Konjugationen flexibel und das wichtigste Vokabular aus exakt zehn Wörtern besteht, die jeder Kardinal kennen muss:
- Placet! – „Es gefällt (mir)“ oder kurz: „Ich stimme zu“
- Extra omnes! – „Alle hinaus!“ (Ruf zu Beginn des Konklaves, wenn nur noch die Kardinäle bleiben dürfen)
- Habemus papam! – „Wir haben einen Papst!“ (verkündet nach der Wahl eines neuen Pontifex)
- Urbi et orbi – „Der Stadt (Rom) und dem Erdkreis“ (päpstlicher Segen an Weihnachten und Ostern)
- Nihil obstat – „Es steht nichts entgegen“ (Zensurfreiheitsvermerk bei kirchlichen Publikationen)
Wer im vatikanischen Alltag mithalten will, braucht kein fließendes Latein. Es genügt, wenn man bei einem Treffen nickt, sobald ein anderer nickt. Wird ein Dekret vorgelesen – auf Latein, versteht sich –, antwortet man idealerweise mit einem wissenden „Placet“. Was das bedeutet? Nun, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, es klingt päpstlich.
Latein in der Kurie ist keine Sprache, sondern ein Zustand: eine Mischung aus zeremonieller Gravität, liturgischer Würde und dem beruhigenden Gefühl, dass niemand wirklich versteht, was da gerade gesagt wurde – am allerwenigsten der Sprecher selbst.
Und so ist es vielleicht ganz gut, dass die meisten Kurialen Latein lesen können, aber es nicht sprechen müssen. Denn sonst müsste man irgendwann erklären, warum ein Lehrschreiben über die Sakramentenordnung sich liest wie ein römischer Bauantrag von 1873.
Fazit: Latein im Vatikan ist wie das gute Porzellan im Schrank. Man braucht es nicht jeden Tag – aber wehe, es fehlt, wenn hoher Besuch kommt. Für alles andere gibt es spezialisierte Übersetzer in Hülle und Fülle.
Fazit:
Ein Kardinal muss Italienisch nicht beherrschen – aber wer es nicht kann, ist im Vatikan ein Außenseiter. Viele lernen es daher spätestens, wenn sie regelmäßig in Rom zu tun haben. Besonders Kardinäle der römischen Kurie sprechen oft fließend Italienisch.
Das Italienische ist im Vatikan eine Art heimlicher Kompass. Wer es beherrscht, schwimmt mit – wer es nicht kann, muss schwimmen lernen. Aber das Papsttum war schon immer eine Mischung aus Welttheater, Diplomatie, Glaubensbekenntnis und gelegentlichem Sprachchaos.
Bildquellen:
- italienisch: Peter Wilhelm KI