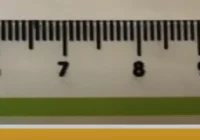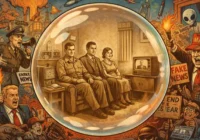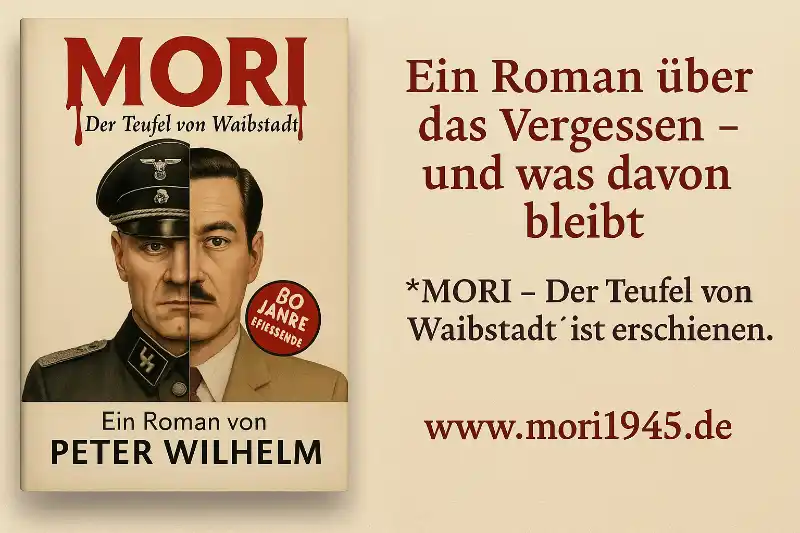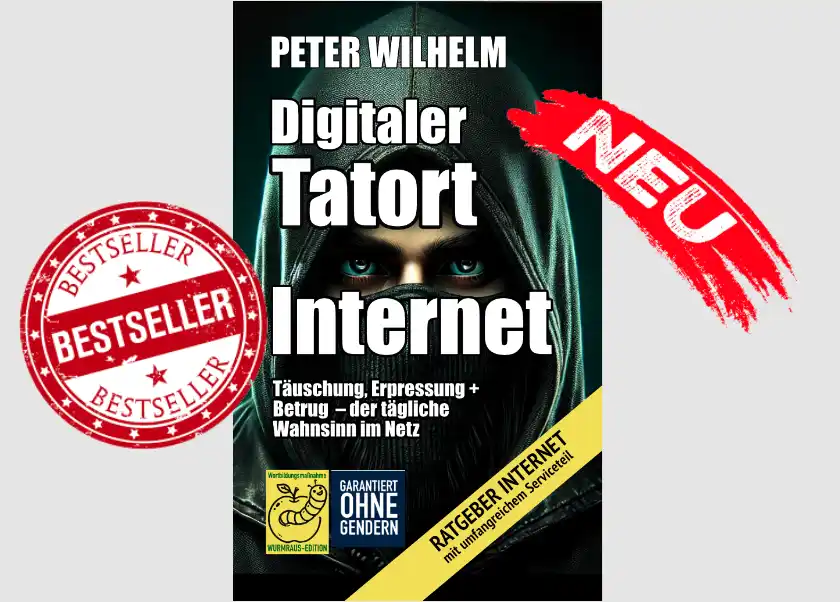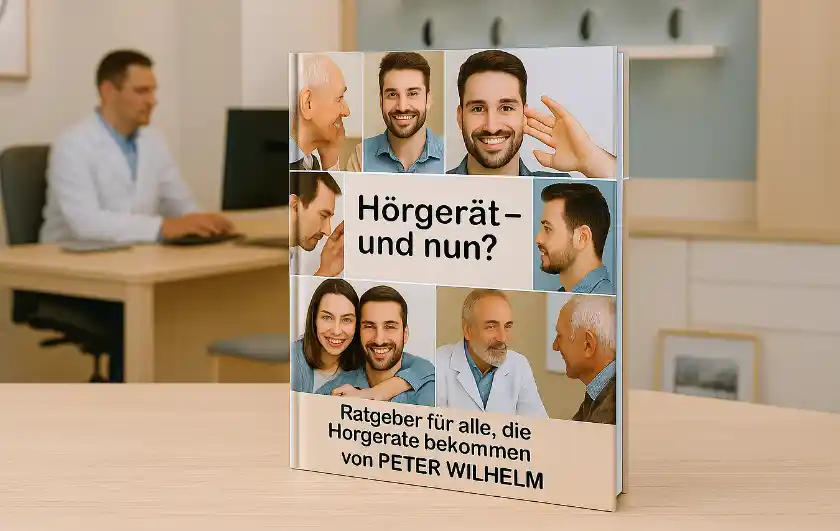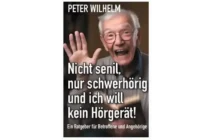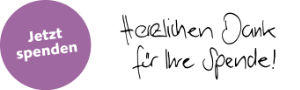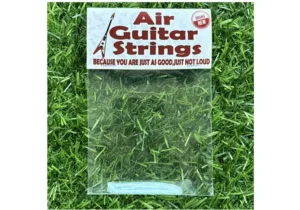Es war einmal in den 1970er-Jahren. Eine Zeit, in der alles neu, modern und unbedingt fortschrittlich sein wollte. Die sexuelle Revolution fegte durch die Gesellschaft wie ein Frühlingssturm, und natürlich durfte das Fernsehen nicht zurückbleiben.
ansehen/verstecken
- Oswalt Kolle war kein Aufklärer
- Queer ist nicht die Normalität
- Vorauseilender Gehorsam – auch irgendwie typisch deutsch
- Hauptsache, die Nebensache wird zur Hauptsache
- Umerziehung? Darf man nicht sagen!
- Das ist alles normal. Die Mischung macht’s
- Zwischengedanke:
- Die Brandmauer quer durch die Gesellschaft
- Die Mechanik der Totschlagargumente
- Die Umdeutung von Normalität
- Das große Schweigen
- Die Brandmauer und ihre gesellschaftliche Spaltung
- Toleranz und Realität: Ein ehrlicher Blick
- Schwul und trans ist nicht genug
- Die Folge: Schere im Kopf
- Fazit: Eine Gesellschaft im Würgegriff der Ideologie
Oswalt Kolle war kein Aufklärer
Kein Film, keine Serie, keine Show, in der nicht irgendwo eine nackte Brust ins Bild gehalten wurde. Krimis? Natürlich mit Sexszenen. Talkshows? Unbedingt mit einem sogenannten Sexualtherapeuten, der erklärte, warum es völlig normal sei, dass die brave Hausfrau nun eine offene Ehe führen sollte. Wer daran Anstoß nahm, galt als prüde, rückständig oder gar als Reaktionär, der sich noch nicht von seinen spießigen, biederen Moralvorstellungen befreit hatte. Die Botschaft war klar: Wer nicht mithielt, war einfach nicht modern genug.
Leute wie der Journalist und Autor Oswalt Kolle gelten heute als „Aufklärer der Nation“, weil sie Nacktheit und Sexualität „in die deutschen Wohnzimmer brachten“. Die Filme und Bücher dieser Autoren wurden damals auch als so etwas wie eine Befreiung empfunden.
Es gab beispielsweise auch viele Sendungen, in denen die Sexartikel-Unternehmerin Beate Uhse eingeladen wurde, die dann erschreckend farblos auftrat und kein bißchen für einen erotischen Nervenkitzel sorgen konnte. Und um den ging es den allermeisten Autoren und Drehbuchschreibern damals ganz gewiss. Wer etwas produzieren wollte, über das morgen gesprochen wurde, der packte einen nackten Schimanski oder eine barbusige Ingrid Steeger mit hinein.
Die heute noch meistgesehene Tatort-Folge „Reifeprüfung“ in der die blutjunge Nastassja Kinski nackt gezeigt wurde, war ein deutschlandweites Thema. Für die Dramaturgie des Krimis waren die Nacktszenen vollkommen überflüssig. Heute geht Nastassja Kinski übrigens gegen die Ausstrahlung dieses Krimis vor, sie sei einfach mit 15 viel zu jung gewesen, um die Tragweite damals richtig einschätzen zu können; aber das nur nebenbei.
Ich erinnere mich gut an den ersten schwulen Kuss im deutschen Fernsehen, dargeboten von Martin Armknecht und Georg Uecker in der Lindenstraße. Was bei vielen Zuschauern für Irritationen sorgte, war ein mutiger Schritt der Drehbuchautoren und des Produzenten. Es gibt keinen nachvollziehbaren Grund, diese Facette unseres Lebens nicht auch im Fernsehen zu zeigen. Gerade in der Zeit, als Schwule noch ausgegrenzt und verfolgt wurden, waren solche Statements wichtig und haben viel bewegt.
Ich persönlich war befremdet, weil es mir so seltsam vorkam, dass ein Mann einen anderen Mann in dieser Weise küsste. Das hat meiner Meinung nach überhaupt nichts mit meiner Sozialisation zu tun, sondern rührt aus einem Urinstinkt her, gegen den man machtlos ist. Ich war nicht abgestoßen davon, ich empfand es nicht als etwas Schlimmes, aber es befremdete mich. Meine katholische Mutter zeigte sich entrüstet und schimpfte darüber wie ein Rohrspatz. Mein Vater (*1916) schüttelte nur belustigt den Kopf und meinte: „Gibt es überall, aber muss man das zeigen?“
Es gingen einige Jahre ins Land und die Lindenstraßen-Sensation war längst keine mehr, als mein Vater dann irgendwann bei einem Tatort meinte, als zum wiederholten Male homosexuelle Liebe gezeigt oder angedeutet wurde: „Irgendwann wird das noch zur Pflicht, ich kann es nicht mehr sehen.“
Queer ist nicht die Normalität
Heute erleben wir dasselbe Schauspiel erneut – mit anderem Thema. Wo früher möglichst viele entblößte Körper ins Bild gerückt wurden, sind es nun queere Lebensentwürfe, Transgender-Protagonisten und die allgegenwärtige Diversity-Agenda. Es gibt kaum noch eine Serie, in der nicht mindestens eine homosexuelle Liebesgeschichte vorkommt. Ein Film ohne transidente Figur? Undenkbar! Familien, wie sie die breite Masse tatsächlich lebt – also mit Vater, Mutter, Kindern? Inzwischen fast schon eine Seltenheit, weil das zu sehr dem klassischen Rollenbild entspricht, das man ja unbedingt aufbrechen muss.
Mir ist es egal, was für eine sexuelle Orientierung jemand hat. Aber diese sexuelle Orientierung muss mir doch nicht bei jeder Gelegenheit aufs Brot geschmiert werden. Mir ist das manchmal einfach zu viel, wenn schon wieder einer der Söhne des Kommissars sich als Schwuler outet, oder wenn thematisiert wird, dass die geschiedene Frau jetzt in einer lesbischen Beziehung lebt. Das hat oft mit der eigentlichen Handlung überhaupt nichts zu tun, bringt die Story nicht voran, soll aber wohl zeigen, dass vor allem öffentlich-rechtlich produzierte Sendungen „offen für solche Themen“ sind.
Vorauseilender Gehorsam – auch irgendwie typisch deutsch
Die Muster gleichen sich frappierend: Früher galt als verklemmt, wer nicht jede Nacktszene begeistert aufnahm, heute gilt als reaktionär oder gar als „rechts“, wer sich fragt, warum plötzlich in jedem zweiten Film der biedere Vater aus dem Vorort heimlich mit seinem besten Freund schläft oder warum eine Serie über das Mittelalter unbedingt eine nicht-binäre Ritterin braucht. Die Unterhaltungsindustrie wirft uns diese Themen inzwischen mit einem pädagogischen Eifer um die Ohren, dass man sich fast fragt, ob irgendwo in den Sendern eine ideologische Checkliste abgearbeitet wird.
Hauptsache, die Nebensache wird zur Hauptsache
Beispiele gefällig? Da haben wir „Tatort“, eine Serie, die früher schlicht und ergreifend Kriminalfälle zeigte. Heute muss in jeder dritten Folge die sexuelle Identität des Kommissars thematisiert werden, als sei dies für die Lösung eines Mordes von zentraler Bedeutung. Oder nehmen wir Netflix-Produktionen: Ganz gleich, ob es sich um eine Adaption eines Klassikers handelt oder um eine Fantasy-Serie – es gibt praktisch keine Erzählung mehr, die nicht zwanghaft mit Diversity-Elementen durchzogen wird. Ob die historische Genauigkeit darunter leidet? Ach, wen interessiert das schon, Hauptsache, es wird ein Zeichen gesetzt.
Umerziehung? Darf man nicht sagen!
Man könnte fast meinen, dass wir es hier mit einer Art ideologischem Umerziehungsprogramm zu tun haben. Denn so wie in den 1970ern der allgegenwärtige Sex eine Normalisierung bewirken sollte, so soll heute die Omnipräsenz von LGBTQ+ Themen jeden Zuschauer mit der Botschaft impfen, dass alles, was nicht in das klassische Familienbild passt, nicht nur vollkommen normal, sondern eigentlich sogar vorzuziehen ist. Und wer das nicht gut findet, wer sich einfach nur fragt, warum er in seinem abendlichen Unterhaltungsprogramm ständig belehrt wird, der ist vermutlich ein Ewiggestriger, der es einfach nicht kapiert hat.
Das ist alles normal. Die Mischung macht’s
Das Problem ist dabei nicht die Darstellung dieser Lebensentwürfe an sich. Es gab schon immer homosexuelle Menschen, es gab schon immer Transpersonen, es gab schon immer unterschiedliche Familienmodelle. Aber die Häufigkeit, mit der sie uns in den Medien vorgesetzt werden, vermittelt ein völlig verzerrtes Bild der Realität. Wer sich ausschließlich auf Netflix, ARD und Co. verlässt, muss zu dem Schluss kommen, dass die Mehrheitsgesellschaft inzwischen aus queeren Paaren, polyamoren Beziehungen und nicht-binären Kriegerinnen besteht, während klassische Familienkonstellationen fast schon exotisch wirken.
Man muss sich ernsthaft fragen: Ist das noch realitätsnahe Abbildung oder schon Ideologie? Früher war es die schamlose Sexualisierung, die als Befreiung gefeiert wurde, heute ist es die übertriebene Repräsentation von Identitäten, die in Wirklichkeit nur einen kleinen Prozentsatz der Gesellschaft ausmachen. Beides führt zu einer Entfremdung vom echten Leben, in dem die meisten Menschen sich schlicht nicht wiederfinden.
Zwischengedanke:
Es wäre schön, wenn das Fernsehen wieder zur Normalität zurückkehren würde. Zu einer Welt, in der Geschichten um ihrer selbst willen erzählt werden, nicht um ideologische Statements zu setzen. Eine Welt, in der man Filme schauen kann, ohne das Gefühl zu haben, dass einem gerade eine politische Botschaft eingebläut wird. Aber wahrscheinlich müssen wir, genau wie in den 1980ern, erst eine Gegenbewegung erleben, bis das Pendel sich wieder in Richtung Normalität bewegt.
Die Brandmauer quer durch die Gesellschaft
Die Brandmauer ist nicht mehr nur ein Begriff aus der IT-Sicherheit oder der Politik – sie zieht sich heute quer durch unsere gesamte Gesellschaft. Wer glaubt, wir hätten eine offene Diskussionskultur, in der man über verschiedene Sichtweisen sprechen kann, täuscht sich gewaltig. Denn in der Realität gibt es eine klare Trennlinie: Auf der einen Seite stehen diejenigen, die die moderne Welle der Diversitätsthemen – LGBTQ, Gender-Ideologie, Trans-Aktivismus – in die Köpfe der Menschen hämmern wollen, auf der anderen Seite diejenigen, die das kritisch hinterfragen oder schlicht nicht in jedem Lebensbereich damit konfrontiert werden wollen. Und wehe dem, der sich zur zweiten Gruppe bekennt.
Die Mechanik der Totschlagargumente
Kaum wagt es jemand, die schiere Omnipräsenz dieser Themen zu hinterfragen, wird sofort die Nazi-Keule ausgepackt. Wer sich beispielsweise fragt, weshalb in nahezu jeder neuen TV-Serie oder Fernseh-Produktion homosexuelle oder transidente Figuren vorkommen, der muss sich warm anziehen. Die Reaktion folgt blitzschnell: „Bist du homophob?“, „Bist du etwa ein ewig Gestriger?“ oder „Du willst also zurück in die 50er Jahre?“ – als gäbe es nur Schwarz und Weiß.
Diese Technik ist perfide: Sie unterbindet jede kritische Auseinandersetzung, weil jeder Versuch einer Diskussion direkt in eine moralische Ecke gedrängt wird. Kritische Stimmen werden nicht argumentativ widerlegt, sondern stigmatisiert und ausgegrenzt. Wer ein Problem damit hat, dass in der Werbung für Joghurt plötzlich mehr Regenbogenfarben als Früchte zu sehen sind, wird gleich als „rechtsradikal“ abgestempelt.
Die Umdeutung von Normalität
Die Medien und viele große Konzerne haben sich längst dieser Agenda angeschlossen. Jede große Marke färbt ihr Logo während des Pride-Month in Regenbogenfarben, selbst die Bundeswehr wirbt mit gendergerechten Kampagnen um Nachwuchs. Wer sich das als unbeteiligter Beobachter ansieht, bekommt den Eindruck, dass die klassische Vater-Mutter-Kind-Familie ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten sei.
Interessanterweise geht es nicht nur um Sichtbarkeit, sondern um die Verschiebung des Normalitätsbegriffs. Während früher eine Vielfalt von Lebensmodellen einfach existierte, wird heute massiv darauf hingearbeitet, bestimmte Lebensentwürfe als einzig akzeptable Wahrheit darzustellen. Wer eine klassische Familie lebt, wird zunehmend als „privilegiert“ oder „konservativ“ gebrandmarkt.
Das große Schweigen
Das wirklich Dramatische ist jedoch nicht nur die mediale Dauerbeschallung, sondern das daraus resultierende gesellschaftliche Klima. Die Menschen haben Angst, ihre Meinung zu sagen. Wer in einer Talkshow äußert, dass er sich nicht in jeder Kinderserie mit Gender-Themen konfrontiert sehen möchte, hat seine gesellschaftliche Ächtung fast schon sicher. Arbeitgeber distanzieren sich, Social-Media-Plattformen schränken die Reichweite ein, die öffentliche Meinung wird gelenkt.
Genau diese Angst ist es, die eine echte Diskussion unmöglich macht. Die Brandmauer trennt nicht mehr nur verschiedene politische Lager, sondern zieht sich mitten durch Familien, Freundeskreise und Betriebe. Es herrscht ein Klima, in dem jeder genau abwägen muss, was er sagt, aus Angst, als „falsch denkend“ identifiziert zu werden.
Die Brandmauer und ihre gesellschaftliche Spaltung
Es wird also zunehmend eine massive gesellschaftliche Brandmauer gezogen – eine Grenze, die sich quer durch alle Bereiche des öffentlichen Lebens zieht. Auf der einen Seite stehen die wenigen, aber lautstarken Vertreter der sogenannten „progressiven“ Bewegung, die ihre Agenda mit aller Kraft in die Köpfe der Menschen hämmern wollen. Sie propagieren LGBTQ+-Themen, Gender-Ideologien und alternative Lebensentwürfe als das einzig Wahre und Fortschrittliche. Wer diese Sichtweise infrage stellt oder auch nur kritisch hinterfragt, wird gnadenlos in die rechte Ecke gestellt.
Hier kommt die Nazi-Keule ins Spiel. Kaum wagt es jemand zu bemerken, dass unsere Medienlandschaft in den letzten Jahren von einer Flut solcher Themen überrollt wurde, wird ihm direkt unterstellt, rechtsradikale Tendenzen zu haben. Es wird nicht mehr diskutiert oder argumentiert, sondern direkt diffamiert und mundtot gemacht. Wer das „neue Normal“ nicht kritiklos übernimmt, wird ausgegrenzt und als rückständig, homophob oder gar faschistisch abgestempelt. Dabei geht es nicht um echten gesellschaftlichen Fortschritt oder Gleichberechtigung, sondern um die Durchsetzung einer bestimmten Ideologie mit autoritären Mitteln.
Diese Taktik wird zudem mit klassischen Totschlagargumenten kombiniert: „Wer nicht für uns ist, ist gegen uns.“ Wer sich kritisch über die immer wiederkehrende Inszenierung von LGBTQ+-Figuren in jedem Film, jeder Serie und jeder Talkshow äußert, gilt sofort als „Feind der Vielfalt“. Wer den inflationären Gebrauch von Gendersternchen und neuen Pronomen hinterfragt, wird als Hassprediger dargestellt. Es geht längst nicht mehr um Gleichberechtigung, sondern um die Errichtung eines neuen Dogmas, das jede Form von Abweichung bestrafen will.
Toleranz und Realität: Ein ehrlicher Blick
Um eines klarzustellen: Ich bin absolut tolerant gegenüber verschiedenen Lebensentwürfen. Es ist mir völlig egal, ob jemand queer, schwul oder transident ist. Jeder Mensch soll sein Leben so führen, wie es für ihn oder sie am besten ist. Ich habe schwule Freunde und kenne zwei Menschen in meinem persönlichen Umfeld, die den Weg der Transition vom Mann zur Frau mit all den Herausforderungen, die damit einhergehen, erfolgreich gemeistert haben. Ich freue mich ausdrücklich darüber, dass homosexuelle Paare heute weitgehend ohne rechtliche und gesellschaftliche Restriktionen zusammenleben können.
Ich bin auch der Meinung, dass all das als normal angesehen werden sollte – im Sinne von akzeptiert und respektiert. Aber es ist eben nicht die gesellschaftliche Norm im statistischen Sinne. Die Norm ergibt sich aus dem, was von der Mehrheit gelebt wird. Homosexualität und Transidentität betreffen jedoch nur einen sehr kleinen Prozentsatz der Bevölkerung. Deshalb ist es problematisch, wenn so getan wird, als sei dies nun das neue Normale oder gar eine erstrebenswerte Lebensweise, bei deren Nicht-Nachahmung man sich als Nazi verdächtig macht. Toleranz bedeutet nicht, dass man gesellschaftliche Realitäten leugnet oder sich einer Ideologie unterwirft. Sie bedeutet, dass jeder Mensch respektiert wird, unabhängig von seiner Identität – aber ohne den Zwang, eine bestimmte Sichtweise als allein gültig anerkennen zu müssen.
Schwul und trans ist nicht genug
Diese Mechanismen sind jedoch keineswegs auf sexuelle Themen beschränkt. Die gleiche Brandmauer, die gleiche reflexhafte Diffamierung und die gleichen Totschlagargumente lassen sich in vielen anderen gesellschaftlichen Debatten beobachten. Wer es wagt, während der COVID-19-Pandemie kritische Fragen zu stellen – sei es zur Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen oder zu möglichen Nebenwirkungen der Impfstoffe –, wurde sofort als „Schwurbler“ oder „Querdenker“ abgestempelt. Genauso erging es denjenigen, die die Maßnahmen befürworteten und sich nicht irgendwelche propagierten Verschwörungstheorien angeschlossen hatte. Wer es wagt, den Klimawandel differenziert zu betrachten und beispielsweise über wirtschaftliche Auswirkungen der Energiewende zu sprechen, gilt schnell als „Klimaleugner“. Und wer es sich erlaubt, auf die realen Probleme unkontrollierter Migration hinzuweisen, wird allzu oft als „Rechter“ oder gar „Nazi“ gebrandmarkt. In all diesen Fällen funktioniert das gleiche Prinzip: Eine kleine, lautstarke Gruppe bestimmt, was sagbar ist, und wer auch nur im Ansatz abweicht, wird sozial geächtet und mundtot gemacht.
Die Folge: Schere im Kopf
Ein weiteres beunruhigendes Phänomen ist, dass immer mehr Menschen sagen, sie würden sich nicht mehr trauen, offen ihre Meinung zu äußern. Die typische Gegenreaktion darauf lautet dann sofort: „Aber das Grundgesetz garantiert doch die Meinungsfreiheit!“ oder „Dank sozialer Medien kann heute jeder so einfach wie nie zuvor seine Meinung verbreiten!“ – Doch diese formale Meinungsfreiheit bedeutet wenig, wenn der gesellschaftliche Druck so groß ist, dass viele es schlicht nicht mehr wagen, sich ehrlich zu äußern. Die lautstarke, dogmatische Minderheit korrigiert gnadenlos jede Abweichung von der erwünschten Haltung, während ein erheblicher Teil der Bevölkerung aus Angst vor sozialer Ächtung oder beruflichen Nachteilen in vorauseilendem Gehorsam mitspielt oder sich einfach gar nicht mehr äußert. Dieses Phänomen, dass Menschen nur noch mit der „Schere im Kopf“ herumlaufen, erinnert in vielerlei Hinsicht an das Leben in der ehemaligen DDR: Nach außen hin wurde der Sozialismus bejubelt, die Parolen mitgesprochen, die „richtige“ Haltung demonstriert – doch hinter verschlossenen Türen dachten und redeten die Menschen ganz anders. Mittlerweile ist es doch so, dass heute in vielen deutschen Wohnzimmern und Küchen völlig andere Gespräche geführt werden als in der Öffentlichkeit.
Fazit: Eine Gesellschaft im Würgegriff der Ideologie
Die Art und Weise, wie Debatten heute geführt (oder besser gesagt: unterdrückt) werden, erinnert an eine Gesellschaft im ideologischen Würgegriff. Eine kleine, aber lautstarke Minderheit diktiert, was gesagt und gedacht werden darf, während eine schweigende Mehrheit sich nicht mehr traut, ihre Meinung offen auszusprechen. Wer sich kritisch äußert, wird nicht widerlegt, sondern ausgegrenzt.
Wer sich gegen diesen Trend stellt, wird erleben, wie unbarmherzig die Brandmauer hochgezogen wird – nicht, um Argumente abzuwehren, sondern um Kritiker mundtot zu machen. Und genau das ist das eigentliche Problem unserer Zeit: Eine Gesellschaft, die sich für frei und aufgeklärt hält, aber in Wahrheit jede Abweichung von der neuen Orthodoxie brutal unterdrückt.